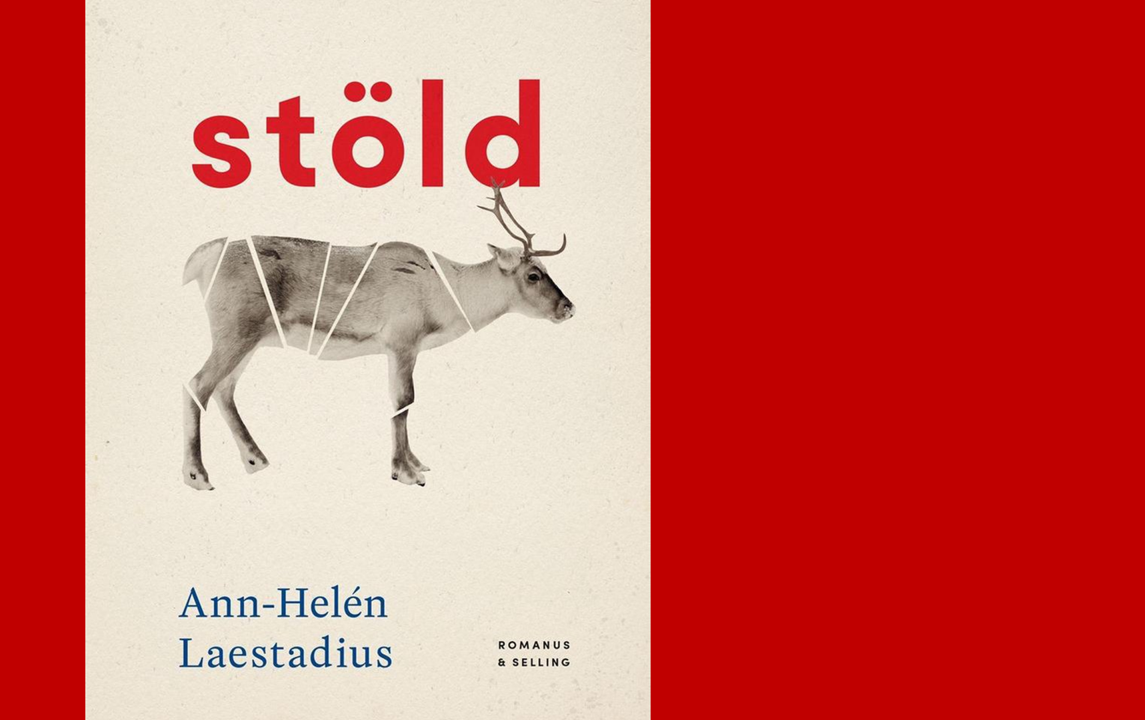Diese Resignation macht sich bei unterschiedlichen Figuren verschieden bemerkbar. Manche Figuren reagieren auf die Diskriminierung damit, dass sie sich klein machen: „Hon måste göra sig liten, nästan osynlig“ [„Sie musste sich klein machen, fast unsichtbar“] und ob ihrer Sorgen schweigen: „Egentligen var det bäst att vara tyst om det mesta om man frågade mamma.“ [„Eigentlich war es das Beste, über die meisten Dinge zu schweigen, wenn man Mama fragte.“] Andere Figuren neigen zu Wutausbrüchen: „Han ville bara ut, bort från alla, det var som att ha en tryckkokare i kroppen, så jävla arg var han.“ [„Er wollte einfach nur raus, weg von allen, es war, als hätte er einen Druckkochtopf in seinem Körper, so verdammt wütend war er.“] Gemeinsam haben alle sámischen Protagonist*innen allerdings, dass sie früher oder später Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit angesichts der multiplen Ungerechtigkeiten, denen sie tagtäglich gegenüberstehen, verspüren: „Elsa kände en plötslig trötthet. Hon hade redan försökt den här vägen, det skulle bara slå tillbaka.“ [„Elsa spürte eine plötzliche Müdigkeit. Das hatte sie schon versucht, es würde nur nach hinten losgehen.“] Die Folge sind gesundheitliche Probleme, vor allem psychischer Natur. Manche Protagonist*innen verarbeiten das kollektive Trauma, indem sie den Schmerz betäuben: „Jag behöver cigg och dricka. […] Dricka, bara bedöva lite av irritationen som kliade i hela kroppen“ [„Ich brauche Zigaretten und etwas zum Trinken. […] Trinken, nur um die Gereiztheit zu betäuben, die mich am ganzen Körper juckte“]; oder versuchen, über das Erlebte zu lachen, um nicht daran zu zerbrechen: „Man måste skratta för annars dör kroppen inifrån.“ [„Man muss lachen, sonst stirbt der Körper von innen heraus.“] Andere Figuren können mit dem Berg an täglichen Sorgen nicht länger umgehen und stürzen in eine lebensverneinende Resignation:
Tänk om det var de som tog livet av sig som gjorde rätt? Som sa att det inte gick längre och lämnade allt som gjorde ont. Som gav hela världen ett statement. Se vad ni driver oss till? Vi orkar inte mer. Vi tar heller livet av oss än ser våra renar plågas och dödas samtidigt som vi hör er hata oss.
[„Was, wenn diejenigen, die sich umgebracht haben, das Richtige getan haben? Die gesagt haben, dass sie es nicht mehr aushalten und alles zurückließen, was wehtut. Die der ganzen Welt ein Statement gesetzt haben. Seht, wozu ihr uns treibt? Wir können es nicht mehr ertragen. Wir bringen uns lieber um, als zuzusehen, wie unsere Rentiere gequält und getötet werden, während wir hören, dass ihr uns hasst.“]
Besonders diese Erzählungen von psychischer Krankheit, Trauma und Selbstmordgedanken untergraben die Legitimität des folkhem-Projekts aus vertragstheoretischer Perspektive. Ein Gesellschaftsvertrag, bei dem die Bürger*innen Teile ihrer Autonomie im Tausch gegen umfassende Sozialleistungen abgeben, kann als gebrochen gelten, wenn staatliche Behörden diese Vertragsbedingungen nicht gegenüber allen Bürger*innen einhalten. Besonders der schwedische Sozialstaat, der sich mit Gleichheitsbestrebungen und universellen Sozialleistungen rühmt, wird durch die im Roman hervorgetretenen Ausschlussmechanismen und Dysfunktionalitäten in ein fragwürdiges Licht gerückt. Die Erzählungen des staatlichen Versagens im Roman und deren Analyse bringen daher eine wichtige Kritik in die gesellschaftspolitische Debatte über die Gestaltung des Zusammenlebens ein und heben dabei eine Minderheitenperspektive hervor, die im Stimmengewirr oft unterzugehen droht.
Literatur als Medium vermag es in diesem Sinne nicht nur, gesellschaftlich relevante Themen zu behandeln, sondern diese in vielen Fällen erst auf die politische Agenda zu setzen beziehungsweise ein gesellschaftliches Bewusstsein für ein Thema zu schaffen.
* Alle Übersetzungen aus dem Schwedischen durch die Autorin, L.P.